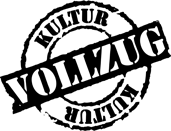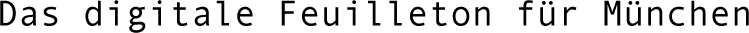Festival Radikal Jung am Volkstheater - der Rückblick
Meditation über das Unausweichliche
Und dann waren da noch: eine gesungene Tagesschau, zwei Frauen, deren Wege sich an einem Checkpoint kreuzen, das Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Und eine Regie-Arbeit, die den selbst gestellten Anspruch von Radikal Jung tatsächlich einlöste: Florian Fischers "Kroniek" gehörte als zu den Höhepunkten des Festivals 2017. Über das Finale, und wer bei Radikal Jung 2017 gewonnen hat: Mehr in unserer Bilanz der zweiten Hälfte.
Ein Mann, vielmehr: seine Leiche liegt in seiner Wohnung. Niemandem fällt das auf, Nachbarn beschweren sich mal über schlimmen Geruch, aber das geht vorüber. 28 Monate lang liegt er da, sein Körper geht durch alle Stadien der Verwesung. Das Licht brennt, der Fernseher läuft, der Wasserhahn tropft die ganze Zeit fast zweieinhalb Jahre lang. Der Briefkasten quillt über, was die Post dazu veranlasst, die Leerung des Briefkastens anzumahnen - mittels eines Briefes. Als man Michel Christen, 53, endlich entdeckt, sind von ihm Haut, Haare, Knochen und ein bisschen Fett übriggeblieben.
Die Geschichte der langsamen Verflüchtigung Michel Christens bietet schon in den Anfangsminuten dieser formal strengen, ungewöhnlichen Inszenierung sehr viel von dem, was ausmacht: Fast schon absurde Komik, Fassungslosigkeit, Trauer, die Frage, wie einsam der allerletzte Abschied ist. "Kroniek oder oder wie man einen Toten im Apartment nebenan für 28 Monate vergisst" beginnt als Bestandsaufnahme einer unglaublichen Vernachlässigung, entwickelt sich dann aber zu einer Meditation um den vielleicht intimsten Augenblick im Leben eines Menschen.
Florian Fischer hat sich für seine "Kroniek" - auszusprechen wie Chronik mit langem "i" - am NT Gent auf die Spuren Christens begeben, hat mit Verwandten, Nachbarn, Gästen seines Stammlokals gesprochen. Christen war Alkoholiker, hatte Kehlkopfkrebs, war andererseits bei der freiwilligen Feuerwehr, überhaupt ein kommunikativer Mensch und eben kein Eigenbrödler. Wie kann es sein, dass man die Fehlstelle nicht bemerkt, die so ein Tod hinterlässt?
Aus den Absurditäten der Behörden, Zitaten, Elementen einer buddhistischen Meditation und Tanz weben Fischers drei Schauspieler einen Abend, der keine Gewissheiten vermittelt, keine Antworten gibt. Es ist ein Abend, der auf verschiedenen Ebenen läuft. Wir hören von einem Freund, der den Moment des Fallens genießt, den Augenblick, da die Finger den Ast loslassen, an den sich der Junge geklammert hat: Ist dieser Moment der Ungewissheit und des totalen Kontrollverlusts so etwas wie ein kleiner Tod? Wir hören später von ihm, wie er einen Ozean allein in einer Nussschale von Boot überqueren will. Glücklich sei er wie nie zuvor, sagt er in seinen letzten Funksprüchen. Schließlich wird das leere Boot gefunden, nur wenige Seemeilen vom Ziel der Reise entfernt. Wollte sein Kapitän nicht mehr ankommen, nie mehr festen Boden unter den Füßen spüren? Führt uns zur Frage, warum sich Michel Christen keine ärztliche Hilfe geholt hat. Wollte er alleine sterben und Herr des allerletzten Verfahrens bleiben?
Im graubärtigen Bert Luppes, in Oscar Van Rompay und in Charlotte Vanden Eynde hat Fischer drei charismatische Darsteller gefunden, die ihre Annäherung an ein unbeschreibbares Thema tänzerisch und spielerisch unternehmen. Luppes entledigt sich einmal seiner Kleider, steigt in einen Waschtrog, Van Rompay wäscht ihn: Man denkt an Altenpflege, eine Leichenwäche vielleicht sogar. Und hört der Geschichte von dem Einhandsegler zu. Als Luppes ein Seefahrerlied anstimmt und das Publikum zum Mitsummen auffordert, ist man selbst auf See, und das Plätschern um Trog mutet wie der Wellenschlag an. Und schon ist man Teil einer Crew auf einer Reise zu unbekanntem Ziel. Die Schauspieler reichen schließlich Fächer herum: Ein Parfümeur hat zwei Düfte zusammengestellt. Einer riecht, wie Christens Wohnung zu Lebzeiten ihres Bewohners gerochen haben könnte. Der andere nach dem verwesten Christen. Ein scharfer Geruch, der nicht aus dem Hirn verschwindet, als habe er sich in die Kleider gefressen.
Fischers Schauspieler, wir erwähnten es, sind herausragend. Kann der Tod Befreiung sein? Zum Schluss hin tanzt Charlotte Vanden Eynde extatsch zu einem Song von Arcade Fire: "My Body is a Cage". Es geht da um einen, der in einer Zeit lebt, die das Unterste zuoberst kehrt, und sein Körper hält ihn fest. Doch der Geist besitzt den Schlüssel. Zwei Fahnen schwenken Van Rompay und Vanden Eynde dann noch, im selben Muster wie der tapetenähnliche Hintergrund der Bühne (Maarten van Otterdijk). Eine Pose wie aus einem Revolutionsbild. Die Wohnung scheint sich aufzulösen. Und mit dem Fahnenschlag fächeln die beiden einen frischen Duft zum Publikum. Dieser mutige, sehr gegenwärtige Abend zeitigt das älteste aller theatralen Ergebnisse: das Erlebnis der Reinigung, der Katharsis.

"Und nuhun das We-hetter": Die Tagesschau mal gesungen... Warum nicht? Foto: Irina Ximena Perez Berrio
Der 2. Mai 2017
Wie wenig aktuell diese Besprechung ist, merkt man am Titel des Stücks: Die besprochene Aufführung war am 2. Mai, am Tag der Uraufführung hieß das Stück noch 26. November 2015. Regisseur und Autor Jan Philipp Stange lässt die Tagesaktualität in seine Frankfurter "Tagesschau"-Techno-Oper einfließen. Medien sind Theater, und ganz besonders dieser mediale Ritus der Nachrichtensendung, der tagtäglich zehn Millionen Menschen um sich versammelt. Zwei junge, androgyne Sprecher, als Mann und Frau gekleidet, ansonsten aber in Auftreten und Stimmlage sehr, sehr ähnlich, geben die Vorbeter des Rituals, mit dem Mann am Musikmischpult als Hohepriester. Ein Biedermann aus der Provinz (der Ex-Beamte Werner Schneider höchstselbst) erzählt dazwischen aus seinem Leben, als Kontrast zum Pathos der Tagesschau-Geschichtenerzähler (nach griechischem Vorbild also wahrhafte "Sänger"). Die Geschichten aus einem ereignisarmen ganzen Leben sind aber überraschenderweise fesselnder als das Gedöns der Theatertagesschau. Ein Abend wie eine moderne Verpackung: Glänzend und schick aufgemacht, mit überschaubarem Inhalt.
Das Schloss
Das Münchner Volkstheater begeisterte vor einigen Wochen mit seiner Bearbeitung von Franz Kafkas "Schloss". Nicolas Charaux hat da eine witzige und wirklich sehr kafkaeske Produktion hingestellt. Beim Festival gefiel's mir nicht so. Man sah, wie wichtig die Tagesform von Ensemble - oder Betrachter - ist.

Ganz nahe, und doch auf unterschiedlichen Seiten: Die Palästinenserin (Henriette Hölzel) und die Soldatin (Laina Schwarz). Foto: Krafft Angerer
Gott wartet an der Haltestelle
Zwei junge Frauen bewegen sich aufeinander zu, begegnen einander für einen Moment, ein Augenblick mit allen Möglichkeiten der Welt. Doch ihre Voraussetzungen könnten unterschiedlicher nicht sein. Da ist die israelische Soldatin (Laina Schwarz), die am Checkpoint Macht darüber ausübt, wer rüberkommt und wer nicht. Und da ist die Palästinenserin Amal, die auf dem Weg nach Haifa ist. Die Soldatin will sich härter geben als sie ist, am Ende gibt sie nach, sie hört auf ihr Herz. Und lässt Amal, die sie für schwanger hält, passieren. Zu ihrem Anschlag in einem Lokal, der 30 Tote fordern wird.
Pinar Karabuluts Inszenierung von Maya Arad Yasurs Drama "Gott wartet an der Haltestelle" wartet mit ungemein spannenden, berührenden, ja aufwühlenden Szenen auf. Gleich zu Beginn etwa: Die Zuschauer sitzen auf zwei Tribünen längs auf der großen Bühne im Volkstheater. Zwischen ihnen Tische unter Hängelampen: Man darf sich als Gast eines Speiselokals fühlen. Die Handlung spielt sich am und im Publikum ab. Ein Geheimdienstmann macht einem Taxifahrer Vorwürfe: Er hat die Attentäterin nach Haifa gefahren. Währenddessen erzählen andere von ihr, der Frau, mit dem seltsamen Verhalten, die auf einem Tisch in der Mitte des Lokals besteht. Es ist Amal. Sie bestellt etwas, Limo und Huhn. Während die Soldatin immer dringender bittet, ja fleht, man möge das Lokal verlassen, zählt die Frau ihren Countdown herunter. Und dann - nichts. Es ist die Stille, die nach einer Detonation herrschen könnte. Fast hört man seine Ohren pfeifen. Doch dann setzen die ersten Stimmen ein. Von Überlebenden, von Menschen, die nicht ins Lokal kamen. Weil sie zu viele waren, weil sie zu zweit waren, weil sie zu früh gingen, zu spät kamen. Weil sie den Bus verpassten und ihm von der Haltestelle aus hinterherschauen durften
Das sind starke Szenen, ohne Zweifel. Nur passen sie nicht hundertprozentig zusammen.
Karabulut inszeniert souverän, mit allen Mitteln, in einer beeindruckenden Atmosphäre und mit dem Personal, die ein Haus gehobener Klasse wie das Staatsschauspiel Dresden vorhält. Die Schauspieler sind gut, Laina Schwarz sogar sehr gut. Warum nur fesselt die Geschichte einen irgendwann nicht mehr? Weil die Schauspieler so aufs Handwerk setzen, dass man ihnen richtig bei der Ausübung des Berufs zuschauen kann. Das kommt solide, aber nicht beiläufig rüber. Und da kann man schon mal aus der Geschichte fallen.
Vor allem aber ist der Text zu lang für das, was er uns sagen will. Was aber will er uns eigentlich sagen? Geht es um die Ausweglosigkeit eines Konflikts, der seit Generationen anhält und bei dem niemand mehr weiß, wer zuerst da war: Ei oder Henne? Dann wäre Yasur aber an der allerobersten Oberfläche geblieben. Geht es um die Geschichte einer Radikalisierung? Dann bleibt die Autorin erst recht einiges schuldig. Amals Geschichte bleibt rätselhaft, vor allem, weil sich zwischen die vielen Vor- und Rückblenden eine Fragwürdigkeit eingemogelt hat: Einmal spricht die unverheiratete Amal zu ihrem noch gesunden Vater, sie werde einst eine Frau sein, auf die ihr ganzes Volk stolz sein könne. Dann wieder ist der entscheidende Augenblick für ihren Attentatsplan der Tod ihres Bruders, der auf seiner Hochzeit von israelischen Soldaten erschossen wird, als Terrorist. Da ist der Vater schon vom Krebstod gezeichnet. Wann also hat Amal begonnen, ihren mörderischen Plan auszuhecken?
Das Geschehen erreicht den Gipfel am Checkpoint. Amal und ihr todkranker Vater wollen die Grenze passieren, für eine Behandlung in Haifa. Die Soldatin lässt sie zunächst nicht passieren. Eine unbarmherziges, fast unmenschliches Verhalten. Doch die Nachgiebigkeit der Soldatin wird schließlich die Katastrophe ermöglichen. Amal kommt durch, wo sie besser nicht durchgekommen wäre.
Fazit: Es gibt berührende Szenen, aber nicht unbedingt den großen Zusammenhalt. Was man lernt? Dass Mitleid im falschen Augenblick ein beispielloses Verhängnis nach sich ziehen kann. Noch nie hat man den Mauerbau der Israelis so gut nachvollziehen können wie in diesem Augenblick. War das die Absicht des Stücks? Man darf das bezweifeln.
Cock, cock... who's there?
Das Mädchen filmt sich mit dem Smartphone, die Augen irren zwischen Display und einem fernen Punkt im Straßengewühl von Tokio, für ihr Videotagebuch redet sie sich etwas von der Seele. Irgendetwas von Sperma, das sie ausgekotzt hat, zusammen mit Keksen, eine eklige Mischung, die immerhin der Polizei den Nachweis gestattet: Ja, sie war am angegebenen Ort, und: Ja, es gab Sex. Und zwar nicht, weil sie ihn wollte. Kurz darauf sieht man das Gesicht der jungen Frau in Nahaufnahmen, ein engelhaft schönes Antlitz in der einen, ein auf Demi Monde oder anrüchig geschminktes Gesicht in der nächsten Einstellung. Und zur traumhaft schönen Aria "Lascia Ch'io Pianga" aus Händels "Rinaldo" sickert eine milchige Flüssigkeit über ihre Lippen. Die Keksbrösel kann man sich ja dazu denken.
Samira Elagoz ist etwas widerfahren, was die Seele zerstören kann. Zweimal wurde sie vergewaltigt, traumatische Erfahrungen, mit denen die Finnin auf ihre eigene Art umgeht: Sie lässt diese Erfahrungen einfließen in ein Projekt, in dem sie Erzählung, rudimentäre Performance und das Medium des Films souverän mischt. Ist das Theater? Zumindest entwickelt man mit der Figur auf der Bühne Empathie. Doch, man will sich nicht in Samira Elagoz einfühlen, nicht in diesen Augenblicken. Aber man ist nah bei ihr. Andererseits: Es ist ja keine Erzählung, kein Drama - es ist ihr Bericht, darüber, was Männer tun.
Und darüber, wie sie damit umgeht.
Nämlich so: Sie sucht im Internet Männerbekanntschaften, für ein Filmprojekt. Sie geht in all ihrer Verletzlichkeit raus, in die Welt. Das Ergebnis davon wie auch von ihrem nächsten Projekt - wir filmen unseren ersten Kuss - zeigt sie im Volkstheater. Seltsame Typen sieht man da, nette Typen auch, alle legen ein seltsames Balzverhalten an den Tag. Einer ist via Internet bei einer wirklich akrobatischen Art der Selbstbefriedigung anzutreffen. Ein oder zwei Männer sind echt gruselig.
Dazwischen kommen Freunde von Samira zu Wort, ihre Mutter und ihre Großmutter, die ihrerseits von einer Gewalterfahrung berichtet. Dazwischen ist Zeit für Glück. Elagoz aber hat, das erfahren wir in ihrer Erzählung, auch ihren aktuellen Freund bei ihrem Videoprojekt kennengelernt. Die Szenen aus ihrem Kussprojekt sind mitunter sogar romantisch. In solchen Augenblicken erzählt sie uns ein romantisches Märchen, und zwar auf eine Art, die uns finnisch vorkommt - es finden sich darin sehr liebenswürdige und irgendwie skurrile Leute. Etwa ihr Vater, der virtuos und pathetisch arabische Gedichte vorträgt. Das sieht nun wirklich herzallerliebst aus.
Genauer: Es sähe so aus, wüssten wir nicht um die Abgründe. Ein irgendwie stiller, mutiger Auftritt ganz am Ende des Festivals 2017.
Und gewonnen hat...
..."Wenn die Rolle singt" von und mit Thomas Niehaus und Paul Schröder, von Johanna Witt am Thalia-Theater in Hamburg inszeniert. Wir bleiben bei unserem Urteil von vor einigen Tagen: Weder jung, noch besonders radikal. Aber sehr, sehr feine Schauspielkunst. Und wahnsinnig lustig. Das Publikum hat einen der witzigsten Abende der Festivalgeschichte auf Platz eins gewählt.