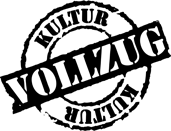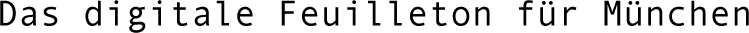Rückblick auf Martin Rosenthals 3D-Märchen bei den offenen whitebox-Ateliers
In Siebenlichtjahrstiefeln durch das All
Im dritten Stock des Werk 3 im Werksviertel - über der whitebox - befindet sich das Atelier von Martin Rosenthal. Der geborene Münchner und Ur-Schwabinger war mit Nikolaus Gerhart, dem vormaligen Präsidenten der Akademie, Ugo Dossi und Helmut Dietl in derselben Schule, Christian Ude war in der Parallelklasse. Die Schule hieß damals Altes Realgymnasium, heute kennt man sie als Oskar-von-Miller-Gymnasium. Seit über 20 Jahren hat Martin Rosenthal einen zweiten Lebens- und Arbeitsmittelpunkt in Hangzhou, Volksrepublik China.
Während der Tage der offenen whitebox-Ateliers, Ende November 2016, zeigte Rosenthal eine magisch abenteuerliche 3D-Wort-Bild-Märchenreise, basierend auf zwölf Gedichten, die mit ihrer Bild- und Klangkraft den Künstler motiviert hatten, auf drei großen Screens mit drei Beamern einen Flug durch ein kosmisches Fantasma dazu zu komponieren. Sein Mitarbeiter Götz Bennewitz lieferte ihm ein reiches, digitales Vokabular von Tools, Gegenständen und stellaren Bewegungen - Wirbel, Schwurbel, Möbiusbänder, Weitenblicke - in Cinema 4 D, das Rosenthal mit den Gedichten zu Raumreisen in "Siebenlichtjahrstiefen" montierte. Und schon die Titel der Gedichte, die es einzeln gebunden in einem Schuber zu haben gibt, deuten an, dass es hier nicht um eine Sci-Fi-Liebe geht oder einen anderen Tanz um ein weiteres golden technisches Kalb: Mit Abzähl-, Schüttelreimen und Kinderliedern wie "Alles für die Katz" (dreimal schwarzer Kater), "Maikäferlied" (flieg...) oder "Birnbaum so blau" nimmt uns der sonore Erzähler (Martin Rosenthal selbst) mit auf seine Fahrt, die uns mal an Peter Pan, mal an Jules Vernes, mal an Giordano Brunos "Zwiegespräche vom unendlichen All und den Welten", mal an Stanley Kubricks 2001 erinnern mag.
Tief drinnen in seinem Weltinnenraum scheinen auch neuplatonische Quellen der Kosmologie Ficinos oder Pico de Mirandolas zu schlummern, am Beginn der Neuzeit als Theologie, Philosophie und Wissenschaft noch gemeinsam spekulierten. So scheint auch Gott als Deus otiosus im Nichtvorhandenen und überall vorhanden. "Wo Sonnenwind mit Sternenmeer sich paaren und donnernd Zukunft zeugen wird jene unsichtbare Wolke generiert, die stetig fließend Sonnenmassen sagenhafter Phantasien neu gebiert, Unmengen von Gedankenursubstanzen für das Weltenall im Ganzen und für spezielle, ganz konkrete Orte, kleinere Gebinde von derselben Sorte. Geeignet auch für diese Welt, für alles, was da kreucht und fleucht und frisst und scheißt und pfeift und bellt.
Während sich in unseren Breiten Milliarden ungelöster Fragen in fürchterlicher Enge drängen bis sie mit selbst gebasteltem Gedankenbruch vermischt zur Explosion gebracht und in der Folge dann mit unvorstellbar großer Wucht den vorgegebenen Rahmen sprengen (aus "Schloss am Meer"). Der menschliche Gedankenbruch! Schon dafür muss man diese Passage lieben. Ein Wort, das nach vorne und hinten strahlt und die Textumgebung wie eine Wortgepäckspinne zurrt und wieder lässt und springen lässt. Zwischen einem lyrischen und einem empirischen Ich zu unterscheiden scheint nicht angebracht. Die Frage eines Woher und Woraus der Erzählerstimme erübrigt sich kraft einer unnachgiebig sanften Präsenz. So direkt die Worte uns auch adressieren, so wenig scheinen sie zurückverfolgt werden zu können zu jemandem, der sie hervorgebracht hat oder hätte. Diese Stimme, die nie eilt oder drängt, durchmisst im Passgang mit der Erde, dem blauen Luftballon, mit hundertfachem Mach das All. Eine Gemütsruhe liegt darin, vorbeiziehend am Bersten und Schmelzen der Welten. Die Stimme ist das Organ der Wörter geworden.
Der Demiurg ist nach Diktat verreist. Es bleiben die pneumatisch behauchten Wörter, sie sprechen selbst. Und die Wörter sind das geworden, was sie bezeichnen. Schleifen, Gedankenbruch, Vierbeiniges, Quarks, kosmisches Zeugs und kosmische Vögel. In seinen Reisen, die mit den Seifenblasen von Kinderreimen beginnen, hat der Sternekoch Rosenthal mit einem großen Kochlöffelschwung im alchemistischen Ofen das Wörter-All in Rotation versetzt und einen kostbaren Moment lyrischer Prima Materia geschaffen. Würde man versuchen, aus den zwölf Gesängen und seinen All-Literationen, seinen Spinning-Wheel-Bildern zurückzufinden zum Urheber, dann endete man nur vor einer Maske hinter der die Stimme hervortönt, "personiert". Vor einer Maske, die sich wie eine Sternenschliere auflöste, fragte man, wer bist du? Sind die Worte der Nachlass eines Menschen-Intermezzos? Eine beiläufige Mundbewegung, scheinbar von einem Zarathustra übrig geblieben, streicht mit Grandezza den Bogen vom Maikäfer zum alles verschlingenden schwarzen Loch. Und weiter geht's.
"Alles, was Flügel hat, fliegt." Was schlicht klingt, ergreift und nimmt einen mit. Nils Holgerson im All. Die Stimme versagt sich die dramatische Allure angesichts schmelzender Welten. Denn wo die Katastrophe am größten, ist Rettung da. Den Texten fehlt die künstlerische Eitelkeit, der bürgerlich dichterische Gestus des Geworfenen, jede Larmoyanz eines lyrisch verendenen Miserable. Die Stimme erzählt, ja argumentiert oder wägt salomonisch und gleich gültig wie die Götter in der schwingenden Vernunft sich spiegelnder Welten, gedenkt des Affen Anthropos, der im Sieg über seine Gegner den Knochen in den Orbit von Raumschiffen wirft, die sich im Walzertakt drehten, wie der Knochen des Siegs sich drehte. Alles dreht sich, alles hat einen Spin, selbst die Erde, die mit hundertfachem Mach durch das Neuland, den sternenkalten Neuraum rast.
Es ist ein Gesang, eine Nabelschau, insofern als sich der Nabel als ein Nebel von Sternen herausstellt, ein Sternennabel. Rosenthal kann dies tun wie ein listiger Druide, ein Catweazle, als Kauz, der aus seinem Baumloch herausschaut oder als amorphes Wortgewand, das als Schleier im luftleeren Raum schwebt und eine unsichtbare Salome umschmiegt. Es ist ein Gesang auch der astrophysikalischen Fragen, der Raumzeit, der Wurmlöcher, der Teilchen, der Spins, der Krümmungen der Standuhren, der Verbiegungen ewiger Perpentikel, gesehen mit den goldenen Augen eines philosophischen Kauzes. Alles ist höchstlebendig, hat den Humor von Morgenstern und die Rhythmik von Homer. Alles wird immer wieder gebrochen und steht schon immer wieder auf. Und schwingt im Immernie. Es hält durch, ohne durchzuhalten, ohne Luft zu holen. Die gestalterische Kraft ist nicht konzentriert, gewillkürt, angestrengt, denn alles kann ineinander gespiegelt werden und nichts widerspricht sich deshalb.
Es ist von gütiger Gleichgültigkeit. Von Gleich-Gütigkeit. Zwölf große Gesänge mit großen Bildern eines digitalen Jules Vernes - und das alles ohne Menschen. Denn man hat ja die Worte, sie berichten unter anderem auch von solchen.